Noch eben glitt ich durch meinen Alltag aus Routinen und Vertrautheit. Nichts, was mich fliegen- aber auch nichts, was mich fallen ließ. Eine monotone Aneinanderreihung von vorhersehbaren Ereignissen. Ereignisse, denen ich von Zeit zu Zeit versuchte, Farbe zu verleihen. Farben, die Restaurants, Bars und Urlaube auf meinen Weg malten. Ein Weg, der so gerade und sauber vor mir lag, dass ich nicht mal mehr eine Karte brauchte, um mich zurechtzufinden. Da war der Job, das Geld, die Ehe und hinten sah ich bereits eine Familie, das Haus und ja, auch die Liebe. Ein Leben, das mir die Sicherheit zurückbrachte, die mir in der Kindheit genommen wurde. Ein fairer Tausch. Eine Rechnung, die aufging. Sie ging auf, solange ich die innere Leere mit der Sicherheit des Weges übertönte.
Doch von Zeit zu Zeit war da diese innere Stimme. Irgendwas wollte sie mir sagen, aber ich hörte nicht hin. Sie war zu leise und sie ließ mich in Ruhe, sobald ich mein Außen mit Dingen füllte. Dinge, die manchmal relevant waren, aber manchmal auch nur das Außen lauter drehten, um die Leere nicht hören zu müssen.
Aber hin und wieder sah ich in der Ferne eine Welle anrollen. Noch war sie so klein, dass ich sie kaum wahrnahm und schnell in die andere Richtung schaute- da, wo nur Ruhe zu sehen war.
Und das ging eine Zeit lang gut, denn ich hatte gelernt, die Wellen zu ignorieren.
Ein schönes Leben.
Und dann, wie aus dem Nichts, wurde mir meine Fähigkeit genommen, meinen Blick zu senken. Auf einmal sah ich sie näher kommen. Unausweichlich türmte sie sich vor mir auf. Wurde immer größer und kam mir näher. Und ich hatte Angst. Angst nicht mehr fähig zu sein, zu schwimmen und getragen zu werden. Den Fluss des Lebens zu verlieren.
Eine Angst, die mich lähmte. Und so stand ich dort, blind für den nächsten Schritt, unfähig das Richtige zu tun. Denn diese Welle war zu groß. Sie war zu dunkel und ich hatte nichts, woran ich mich noch festhalten konnte.
Aber zum Weglaufen war es zu spät, denn sie war bereits da. Ich blickte in ihr Innerstes und sah nichts außer die Dunkelheit des Lebens. Erst nahm sie mir die Stärke, dann die Kontrolle und dann meine Sicht. Orientierungslos ließ ich mich treiben, nicht weil ich es wollte, sondern weil ich nicht anders konnte.
Sie riss alles mit, was ich hatte. Das Zuhause, die Liebe und den Job. Sie spülte es Monat für Monat weiter von mir weg. Und so sehr ich auch versuchte, es festzuhalten, umso größer wurde die Kluft zwischen mir und dem Leben. Diesem Leben, wie ich es mal kannte.
Und die Stimme, die einst noch flüsterte, rief nun nach mir und wiederholte ein Wort. Vertrauen.
Alles, was mir blieb- es war alles, woran ich noch glaubte. Vertrauen.
Dass die Welle abflacht.
Dass ich bald auftauchen kann.
Dass ich wieder atmen kann.
Als ich das nächste Mal die Augen öffnete, erstreckte sich die stille Weite einer mir unbekannten Leere vor mir. Ich versuchte zu erkennen, aber alles mir Bekannte war längst weggespült worden. Ohne Orientierung trieb ich- unsicher, ob ich der richtigen Richtung folgte. Ich spürte die ersten Sonnenstrahlen auf meiner blassen Haut. Nun, wo ich zwar ohne Kompass, aber immerhin mit der inneren Ruhe dahinglitt, nahm ich die Schönheit des Moments wahr.
Die warme Sommerluft nahm mir die unendliche Schwere der letzten Monate und schenkte mir den neuen Rhythmus meines Lebens.
Hier in der neuen Stadt, in der anderen Wohnung und den unbekannten Menschen, fühlte ich mich auf einmal richtig in mir. Wie ein Verschluss, der vorher nicht schließen konnte, weil die Endstücken einfach nicht passten- rastete er nun komplett ein. Mein Inneres synchronisierte sich mit dem Außen und ich fühlte eine neue Freiheit in mir aufsteigen.
Und gerade als ich durchatmen wollte- dachte, es sei überstanden und vor mir läge das neue Leben, erfasste mich die Welle erneut. Drückte ihre Dunkelheit über mich und spülte literweise Traurigkeit durch meinen Körper. Traurigkeit über mein Gehen, das Verlassen, die Verluste und das Scheitern einer Liebe. Das Unbekannte fühlte sich wieder fremd an- Unsicherheit machte sich erneut in mir breit. Ich gestand mir ein, dass ich noch nicht mit beiden Beinen auf dem Boden stand- dass ich immer noch auf der Suche nach Halt war, dass ich noch nicht die Frau war, die ich vor meinem inneren Auge sah- eine Version von mir, die in der Ferne auf mich wartete.
Und auf einmal verstand ich etwas. Etwas, das mir größer vorkam, als ich es je war.
Die Wellen des Lebens sind nicht gegen mich. Sie nehmen das, was nicht mehr passt, damit ich meinem Zukunftsich näher komme.
Orientierungslos zu sein, ist der Moment, in dem ich anfange, mich treiben zu lassen. Mich treiben lassen, ohne an etwas festzuhalten.
Und was ist, wenn das der einzige Zustand ist, in dem ich wirklich frei bin?
Keine Erwartungen, die auf mir lasten,
keine Bedingungen, die ich erfüllen muss,
keine Deadlines die ich einhalten soll.
Einfach Ich- und diese Gewissheit, dass, wenn ich anfange, die Schritte zu gehen, meine Richtung von alleine auf meinem Weg erscheint.
Bis dahin bleibe ich hier.
Ich bleibe hier, schaue nicht auf die Wellen, die hinter mir liegen- aber blicke auch nicht in die Ferne.
Ich bleibe hier, in der Schönheit des Moments, auf dem weißen Blatt Papier, in einer Version von mir, die ich selbst noch nicht kenne.
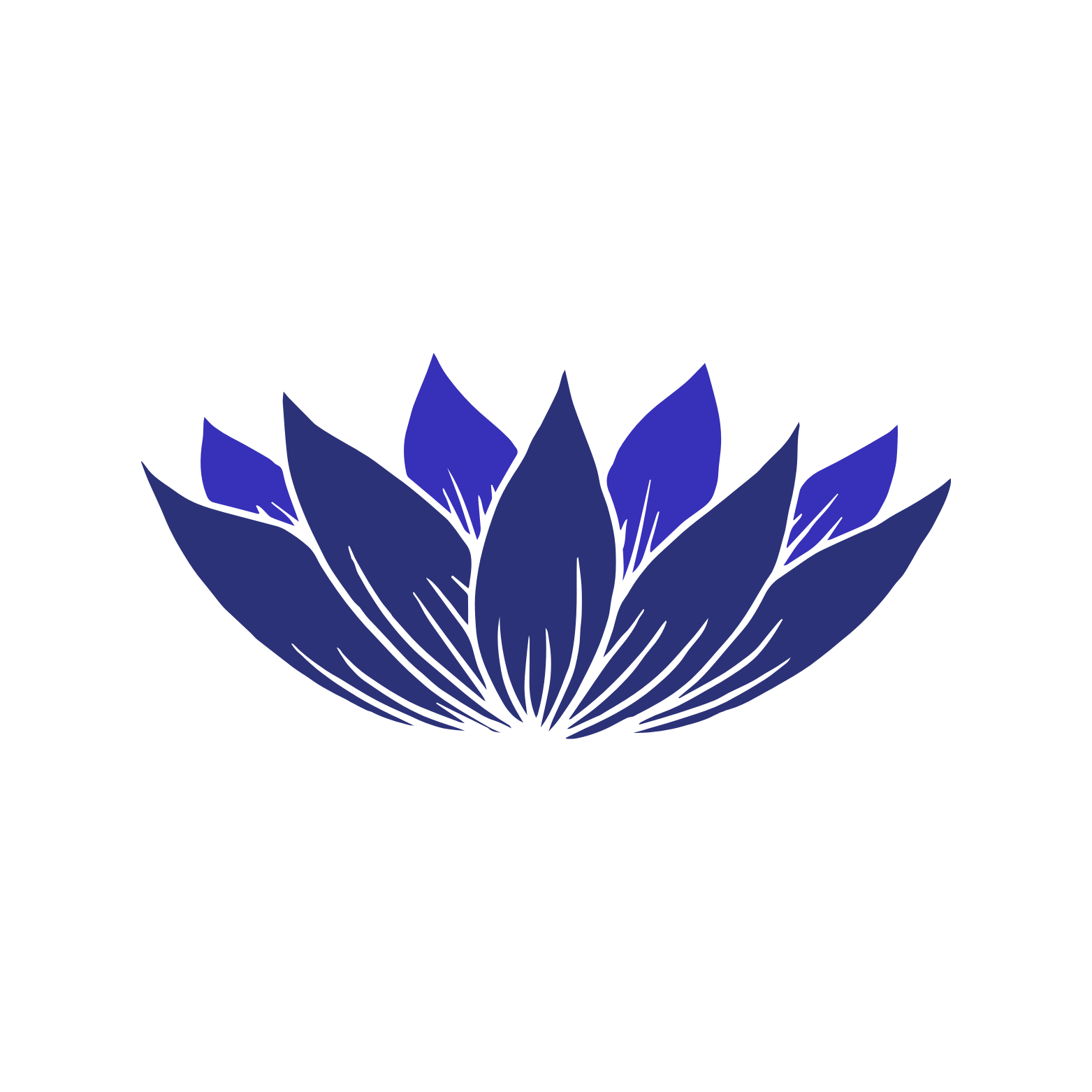
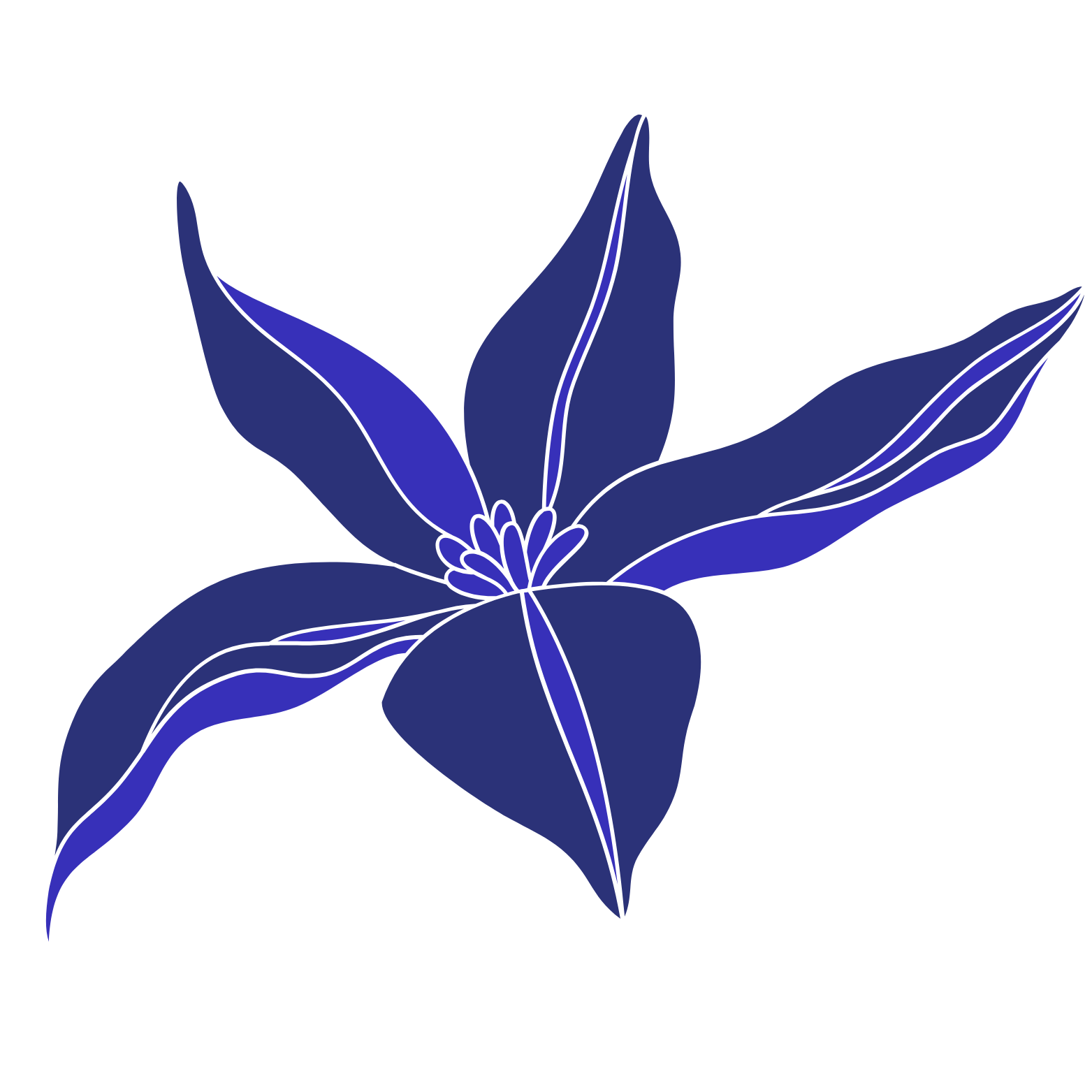
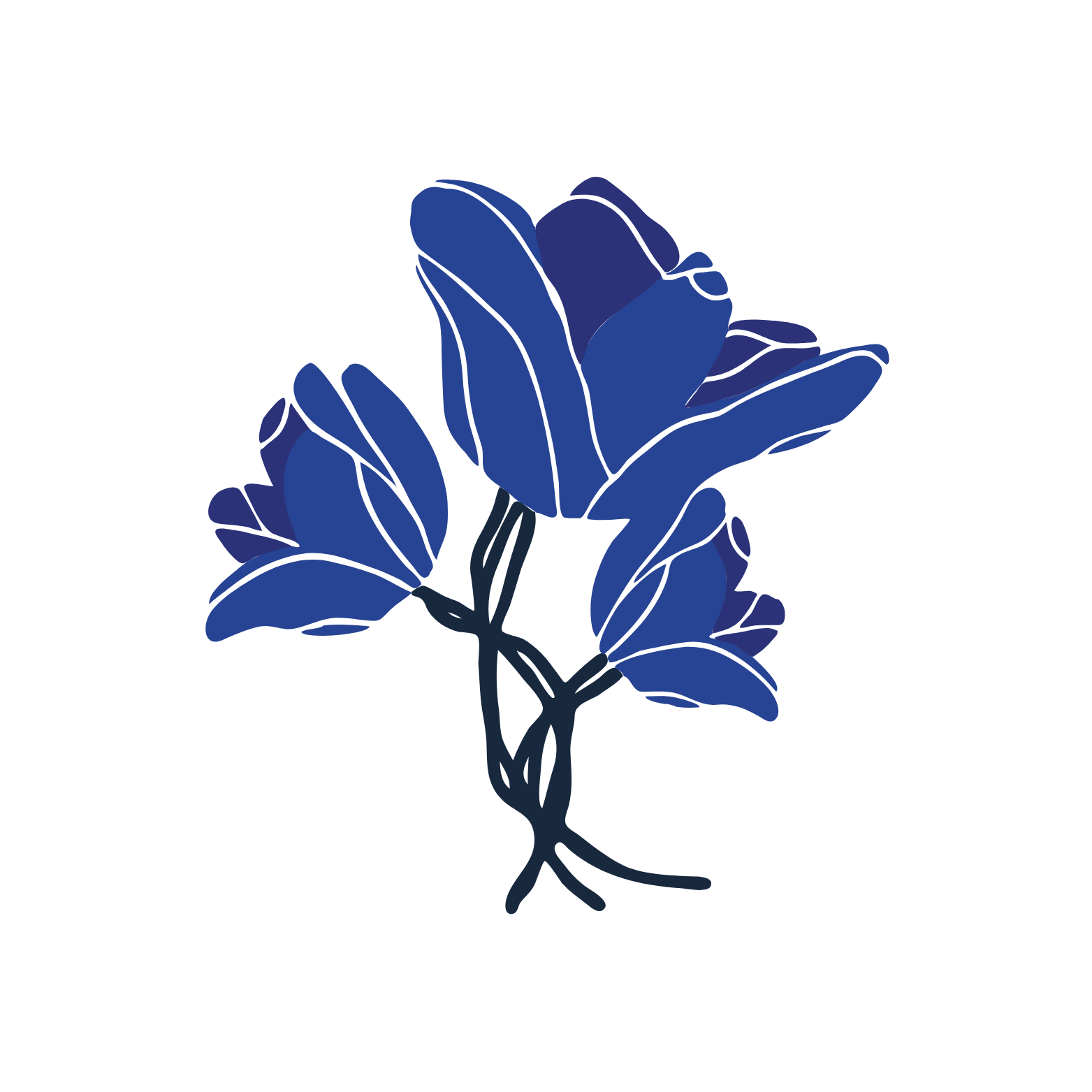







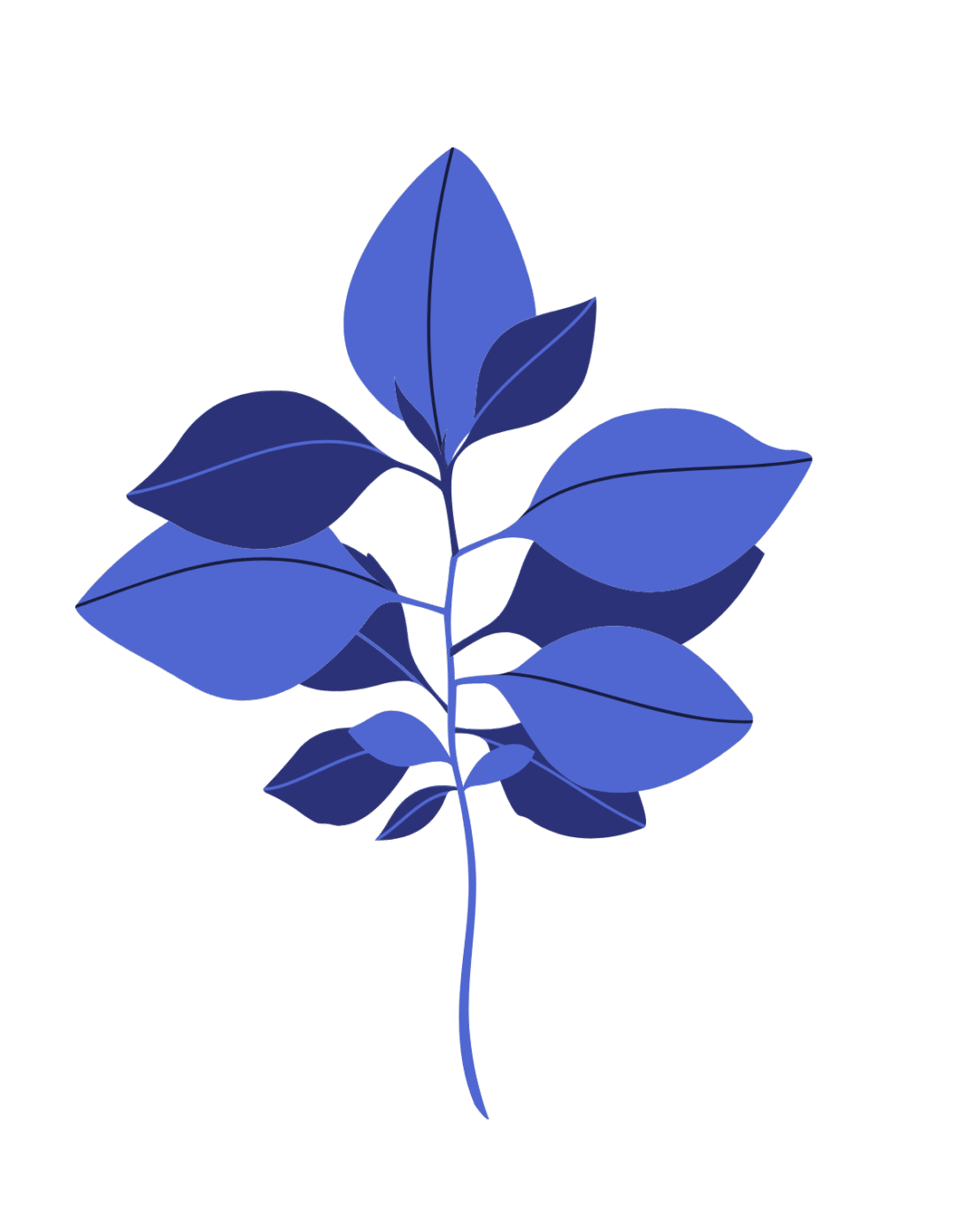

Schreibe einen Kommentar